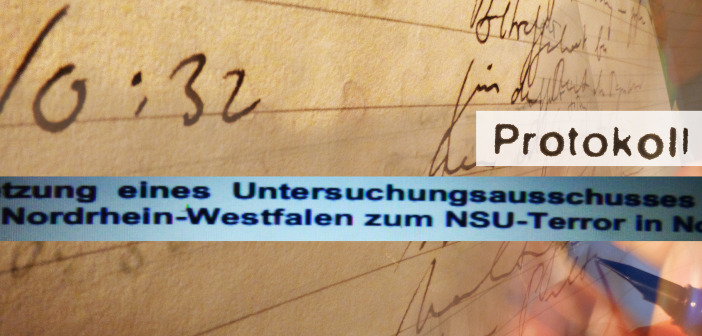Wie in den drei vorhergehenden Sitzungen war auch in der 5. Sitzung des Untersuchungsausschusses (PUA III) am 13. März 2015 der öffentliche Teil einem sogenannten „Hearing“ von Expert_innen gewidmet. Die eingeladenen Sachverständigen David Begrich, Prof. Dr. Hajo Funke, Prof. Dr. Juliane Karakayali und Michael Sturm waren gebeten worden, die Ausschussmitglieder in diesem vierten Sachverständigengespräch über das Thema „Die Entwicklung der extremen Rechten vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bedingungen seit 1990/1991“ zu informieren.
Um 13.05 Uhr eröffnet die Ausschussvorsitzende Nadja Lüders (SPD) die 5. Sitzung des PUA III (NSU) im Düsseldorfer Landtag. Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder und Referent_innen des Ausschusses, die Vertreter_innen der Landesregierung, Zuschauer_innen und Medienvertreter_innen. Namentlich dankt Lüders den Sachverständigen (SV) Karakayli, Funke und Sturm dafür, dass sie „den Weg“ in den Landtag „gefunden“ hätten. Der vierte eingeladene Sachverständige David Begrich fehlt, Gründe hierfür macht die Vorsitzende nicht bekannt.
Wie auch in den vorherigen öffentlichen Sitzungen weist Nadja Lüders auf den Ablauf der Sitzung und die Aufteilung in einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Teil hin. Dies sei „mittlerweile geübte Praxis“. Lüders erwähnt, dass Serap Güler (CDU) zu dieser Sitzung entschuldigt sei und der Kollege Peter Preuß sie vertrete.
Die Vorsitzende bittet die SV, jeweils eine kurze Einführung von 20-25 Minuten zu geben. Vorab weist Lüders auf die potenzielle Möglichkeit der Zeug_innenschaft der Referent_innen hin und bittet sie, dies „anzuzeigen“, da es bereits eine Sitzung gegeben habe, in der „eine Expertin ausgeschlossen werden musste, weil sie als Zeugin benannt werden könnte“. Lüders ergänzt hierzu, dass eine solche Anzeige, sich selbst als mögliche_n Zeug_in einzuschätzen, „möglichst früh“ erfolgen solle. Gleiches gelte für die anwesende Öffentlichkeit. Lüders verweist des Weiteren auf Formalia (Verbot von Bild- und Tonaufnahmen, die Anfertigung eines Wortprotokolls durch den Sitzungsdokumentarischen Dienst des Landtages).
Anders als in den vorangegangenen Hearings werden die Sachverständigen ihre Statements nicht damit beginnen, sich zunächst selbst vorzustellen. Auch verzichtet die Vorsitzende darauf, die Sachverständigen vorzustellen. Stattdessen verweist Lüders auf die Kurzviten der Expert_innen, die dem Ausschuss zuvor zugestellt und hier zur Kenntnis gebracht worden seien, sodass „auch alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.“
Lüders bittet den Sachverständigen Michael Sturm, mit seiner Einführung zu beginnen.
Michael Sturm beginnt und weist darauf hin, dass er sich aufgrund des zeitlich begrenzten Rahmens auf einige Aspekte konzentrieren wolle, die nach seiner Einschätzung „für das Verständnis der Entstehungskontexte“ des NSU wesentlich seien. Auch einige allgemeine Ausführungen zu den Zusammenhängen, Strukturen und Aktionsformen oder auch zur Ideologie der extremen Rechten in der Bundesrepublik seien erforderlich. Dennoch wolle er diese übergreifenderen Ausführungen immer auch konkret auf den NSU beziehen und bei der Fragestellung des Ausschusses bleiben. (Das Skript des Vortrags haben wir hier dokumentiert).
So wolle Sturm in seinem Beitrag vier Aspekte beleuchten:
1. „Das spezifische Politikverständnis des Rechtsextremismus […], das sich in zugespitzer Form im Handeln des NSU widergespiegelt hat“. 2. „Konjunkturen und Auswirkungen dieses spezifischen Politikverständnisses“. Hier sei es ihm wichtig, das Neue aufzuzeigen, das die Entwicklungen des Rechtsextremismus seit den 1990er Jahren geprägt habe. Hier seien eben diese Dynamiken „nicht ganz voraussetzungslos“ gewesen, sodass es wichtig sei, sich auch 3. mit der „Vorgeschichte“ der extremen Rechten in der Bundesrepublik zu beschäftigen, hier insbesondere mit der Zeit der 1970er und 80er Jahre. 4. wolle Sturm den „Charakter der rechtsextremen Strömungen“ in der BRD einordnen und zusammenfassen. Hierzu versuche er, sie mit den Forschungs-Kategorien der sozialwissenschaftlichen Bewegungsforschung abzugleichen.
Zum ersten Punkt führt Sturm aus, er gehe davon aus, dass es jenseits aller Fragmentierungen ein gemeinsames Politikverständnis des „Rechtsextremismus“ gebe, welches sich von anderen Weltanschauungen „grundlegend unterscheidet“. Und dieses Politikverständnis habe sich in einem Zeitraum von 100 Jahren nicht geändert. Der Unterschied spiegele sich in dem Satz „Taten statt Worte“, der im Bekennervideo des NSU veröffentlicht sei, wider. Dies konkreter fassend, nimmt Sturm im Folgenden zunächst Analysen zu Rechtsterrorismus in den Blick. Diese wiesen zumeist darauf hin, dass Rechtsterroristen keine Bekennerschreiben hinterließen, es also so etwas wie einen „bekenntnislosen Terrorismus“ von rechts gebe. Sturm zitiert hierzu den Soziologen Peter Waldmann, der davon ausgehe, dass in diesem scheinbar bekenntnislosen Terrorismus ein Bekenntnis auch nicht nötig sei, solange „unversöhnliche Feindschaft“ der Motor sei, nach dem Motto: Es gibt nichts zu bereden, es gibt nur ein Vorgehen: Gewalt und Vernichtung. Sturm schließt sich dieser Analyse an und sieht sie mehr noch auch für den Rechtsextremismus allgemein gegeben. Er werde dieses Politikverständnis des Rechtsextremismus „Tatglaube“ nennen. Dieser sei handlungsleitend und „im Kern charakteristisch“ auch für den Rechtsextremismus. Wo es unterschiedliche Strömungen gebe, hätten diese hierin einen gemeinsamen Bezugspunkt, nämlich, den „der Aktion“, des „Stils“, der „Inszenierung“ und „Selbstinszenierung“. Diesen Verbindungsklammern käme zentrale Bedeutung zu.
Im Folgenden skizziert Sturm auch die historischen Entwicklungslinien, die dieses Politikverständnis genommen habe. Seinen Rückblick beginnt er dabei Ende des 19. Jahrhunderts, da eben dort die Grundpositionen des Rechtsextremismus entstanden seien, wenn dieser sich auf eine „mythische Weltanschauung“ beriefe, die sich als „Gegenentwurf […] zum Liberalismus“ verstünde und allgemeine Menschen- und Bürgerrechte verneine. Sturm macht in diesem Rückblick stark, dass in dieser Entwicklungslinie entscheidend sei, dass diese Form des extrem rechten Politikverständnisses jede Pluralität diskreditiere. Ihr entgegen setze es „Kollektivsubjekte“ wie Volk und Nation, in ethnischer und/oder kultureller „homogene[r]Einheit. Aushandlungsprozesse oder eine Suche nach Kompromissen gebe es hier nicht. Es gehe vielmehr um die Herstellung einer „homogen gedachte[n]nationale[n]Gemeinschaft“. Die Notwendigkeit, für eine ‚erfolgreiche‘ politische Bewegung programmatische Entwürfe oder Ideologien vorzulegen oder zu erarbeiten, sei hier schon durch die faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit außer Kraft gesetzt worden, da diese in erster Linie gehandelt hätten, sie eine „Praxis an den Tag gelegt“ hätten. Auch der Rechtsextremismus heute funktioniere also, indem mit Aktionismus die eigenen Mythen durch die Tat „plausibel“ gemacht werden sollten, die „Tat“ werde nachvollziehbaren Argumenten im Meinungsstreit entgegengesetzt.
Sturm leitet zu seinem zweiten Punkt über, indem er noch einmal seine These unterstreicht, dass dieser „Tatglaube“ über die Jahrzehnte hinweg und bis heute prägend für den Rechtsextremismus sei, er aber sehr wohl als Kern des extrem rechten Politikverständnisses Konjunkturen durchlaufen habe. Nach 1945 sei der Rechtsextremismus „zunächst sehr angepasst“ gewesen. In dieser Zeit habe es vor allem eine Organisierung in Parteien oder vorpolitischen Organisationen gegeben, die sich „legalistisch gegeben haben“, tatsächlich aber auch versucht hätten, den „politischen Kampf auf der Straße zu führen“. Dazu habe es aber auch Organisationen wie die in den 1990er Jahren verbotene „Wiking-Jugend“ oder Traditionsverbände der Waffen-SS gegeben, die ihren Aktionismus betont und in klarer Bezugnahme auf ein politisches Soldatentum gestanden hätten.
Einen Wendepunkt bzw. einen historisch entscheidenden „Einschnitt“ habe dann das Abschneiden der NPD bei den Bundestagswahlen von 1969 dargestellt. Mit 4,3 Prozent sei die NPD nur knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert. In der Folge sei es zur Herausbildung einer militanten Neonaziszene gekommen, die sich ganz offen in die Tradition des historischen NS und seiner Organisationen gestellt habe, sich auf die historische SA bezogen habe oder sich als Nachfolger der politischen Soldaten von Freikorps und später SA stilisiert hätte. Alle diese Gruppen und Akteure hätten von Beginn an das „Prinzip der Straßenpolitik“ vertreten. Exemplarisch verweist er auf die „Aktionsfront Nationaler Sozialisten“ (Michael Kühnen), die „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei“ (FAP) und die „Nationalistische Front“ (mit Sitz in Bielefeld). Diese Gruppen seien nie an parlamentarischer Akzeptanz oder einem seriösen Auftreten interessiert gewesen. Die Herausbildung von rechtsterroristischen Strömungen der 1970er und 80er Jahre sei in eben diesem Kontext zu sehen.
Und in diesen Zusammenhängen habe sich auch ein stetig breiter werdendes „Spektrum an Aktionsformen“ entwickelt. Rassistische Parolen und offen zur Schau getragene Gewaltbereitschaft hätten dabei auch in Bezug auf andere Jugend- und Subkulturen Einfluss erlangt. Entsprechende Tendenzen seien beispielsweise in der Fußball-, in der Skinhead- oder Rockerszene wahrnehmbar gewesen. Diese „Subkulturalisierung“ oder „Gegenkulturalisierung“ der extremen Rechten habe in den 1990er Jahren „an Dynamik gewonnen“. Nach der Wende sei es zu einem regelrechten „Turn“ im Rechtsextremismus gekommen, da er auf eine „in ganz breiten Teilen der Bevölkerung“ geteilte oder geäußerte „extrem nationalistische Stimmung“ gestoßen sei. Hier verweist Sturm auf den Kollegen David Begrich, der als Experte habe absagen müssen, hierzu aber sicher mehr berichtet hätte.
Zurückgreifend auf Generationen-Theorien spricht Sturm auch von der „Generation Rostock“, die in diesem Kontext prägend gewesen sei. Unter den hier handelnden Akteuren habe es das Gefühl gegeben, ohne jegliche juristische oder polizeiliche Sanktionen, in einem sozusagen „rechtsfreien Raum“ gegen Migrant_innen und politische Gegner hetzen und ihnen gegenüber Gewalt ausüben zu können. Sie habe somit im Gefühl einer „vermeintliche[n]Allmacht im Kampf auf der Straße“ agieren können. Eine gesellschaftliche oder politische Intervention oder Sanktionierung habe es hier in den 1990er Jahren nicht gegeben. Es sei zu einer Entgrenzung rechter Gewalt gekommen. Auch „die Protagonisten des NSU“ ordne er dieser sog. „Generation Rostock“ zu.
Überleitend von der Dynamik zu den Voraussetzungen lenkt Sturm den Blick auf die 1970er und 80er Jahre. Hier seien neue Aktionsformen wie z.B. die „Eselsmasken-Aktion“ entstanden (Mai 1978 – Neonazis seien mit Eselsmasken und mit Schildern um den Hals durch Hamburg gelaufen. Aufschrift der Schilder: „Ich Esel glaube immer noch, dass in deutschen KZ Juden vergast wurden“). Diese Aktion werde bis heute immer wieder aufgegriffen oder adaptiert. Darüber hinaus gebe es eine Reihe an Kadern, deren „politische Karriere“ in den 1970er/80er Jahren begonnen habe. Sie dienten bis heute als „Referenzfiguren“ und nähmen eine bedeutende Rolle ein. Diese Personen, auf die sich die Szene bis heute beziehe, die etwa als Redner fortlaufend eingeladen würden und hierbei der Szene als „Kronzeugen“ oder „Zeitzeugen der Bewegung“ gälten, seien für das historische Bewusstsein des Rechtsextremismus bis heute prägend. Namentlich erwähnt Sturm in diesem Kontext Manfred Roeder, Peter Naumann und Karl-Heinz Hoffmann. Manfred Roeder (mehrere Anschläge mit Todesopfern; 1998 NPD-Kandidatur in Stralsund; 1996 Farbbeutelanschläge auf Wehrmachtsausstellung in Erfurt). Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Ralf Wohlleben seien auch bei Protesten anlässlich eines Gerichtsverfahrens gegen Roeder anwesend gewesen, demonstrierten 1996 in Erfurt vor dem Gerichtssaal. Peter Naumann: Neonazi aus Hessen; Mitte der 1990er Jahre Besitz von Sprengstoff und durchgeführte Sprengstoffattentate; nach Einzug der NPD in den sächsischen Landtag parlamentarischer Mitarbeiter der NPD. Karl Heinz Hoffmann: Wehrsportgruppe Hoffmann; Oktoberfestattentat; Ende der 1980er Jahre Freilassung, trete bis heute als „Zeitzeuge für den Rechtsextremismus“ der 1970er und 1980er Jahre in der gesamten BRD auf. Zusammenfassend macht Sturm hierzu darauf aufmerksam, welch große Bedeutung auch in Bezug auf diese Personen der „Tatglaube“ habe. Denn alle drei hätten nie auch nur einen Text, eine Abhandlung oder ein Manifest geschrieben, auf das sich die Bezugnahme der Szene gründen würde. Sie hätten ihren „Status“ innerhalb der extrem rechten Zusammenhänge vielmehr „allein durch ihr Handeln gewonnen“.
Abschließend bekräftigt Sturm, dass es auch für eine Analyse des Rechtsextremismus nach seiner Einschätzung durchaus tragfähig und fruchtbar sei, ihn als „soziale Bewegung“ zu fassen. Konkreter nimmt Sturm hier auf die sozialwissenschaftliche Bewegungsforschung, namentlich auf Dieter Rucht und dessen Definition „sozialer Bewegungen“ Bezug und führt deren Kernpunkte (auf gewisse Dauer formiertes „Handlungssystem mobilisierter Netzwerke“ von Gruppen und Organisationen, gestützt auf Vorschläge kollektiver Identität, mit dem Ziel, soziale Veränderungen mit Protest bis hin zu Gewalt einzuführen, zu verhindern etc.) für die extreme Rechte aus. Merkmale seien lose Netzwerke, informelle Bewegungen, Schaffung „eigener Kommunikationsräume“ („National befreite Zonen“), Symbolik, Handeln, keine Programmatik, Referenz auf Personen etc. „Tatglaube“, eine geteilte „politische Praxis“, „Kommunikation über Handeln“ seien hierbei nach Sturm unter weiteren Punkten besonders hervorzuheben. So könne der Rechtsextremismus insbesondere in den 1990er Jahre in diesem Sinne als „soziale Bewegung“ gesehen werden.
Diesen Ansatz hält Sturm im Kontext der Aufarbeitung des NSU für besonders „produktiv“, da es nicht um „formale Organisationsstrukturen“ ginge, sondern ein „kulturelles Umfeld“, welches „breitere gesellschaftliche Schichten mit einbezieht“ und in Zusammenhang setzen könne.
Es folgt Applaus und Klopfen der Anwesenden insbesondere der anwesenden Öffentlichkeit.
Nadja Lüders moderiert ab und dankt für die „inhaltlich sehr vertiefte Abhandlung im Schnellverfahren“. Anschließend kommt es kurz zu Irritationen, da nicht ohne weiteres klar zu sein scheint, wer als nächste_r referieren soll. Mit Verweis auf die Obleute erteilt die Vorsitzende Prof. Dr. Hajo Funke das Wort.
So schließt eine knappe halbe Stunde nach Eröffnung der Ausschuss-Sitzung Prof. Dr. Hajo Funke mit seinem Eingangsstatement an. Er beginnt zunächst appellierend: „Von mindestens drei Anschlägen“ in NRW sei im Kontext des NSU die Rede. Da habe es zum einen den Anschlag in der Probsteigasse gegeben. Funke zitiert aus dem Bekennervideo des NSU in seiner „Botschaft“ an das Opfer: „Nun weiß Mashia M. wie wichtig uns der Erhalt der deutschen Nation ist“. Mashia M. habe nun während des Prozesses in München geantwortet: „..die haben so viele Menschen umgebracht und jetzt sind sie so feige, die tun den Mund nicht auf!“ Auch die Attentate in NRW seien, so Funke, nicht rückhaltlos aufgeklärt. Doch nur durch Aufklärung könnten „angemessene Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Dies gelte „für uns, für die Öffentlichkeit, für die Politik und vor allem für die Sicherheitsbehörden“. Funke in Richtung der Ausschuss-Mitglieder: „Ich freue mich daher, dass sie es wissen wollen“. Anschließend verweist er anerkennend auf einige Politiker_innen, die sich bereits maßgeblich in den unterschiedlichen Ausschüssen auf Bundes- und Länderebene eingebracht hätten. Namentlich benennt er z.B. Martina Renner, Katharina König oder Dorothea Marx. Für NRW verweist er auf das Engagement der Piraten im NRW-Landtag, die früh einen Ausschuss gefordert hätten, sowie auf seine Einladung durch die FDP.
Funke gibt den Anwesenden aber auch zu verstehen, dass das Vorhaben des Ausschusses in NRW sehr ambitioniert sei: „Wenn Sie es schaffen […] die Hälfte ihrer 181 Fragen tatsächlich zu beantworten, sind sie weiter als alle bisherigen Untersuchungsausschüsse“. Anschließend positioniert sich Funke als Sachverständiger. Seine Perspektive als Politikwissenschaftler sei begrenzt, er wolle jedoch „nicht oberflächlich […] und auch nicht urteilslos“ sein.
Im Folgenden schildert Funke, wie zuvor Sturm, dass er sich in der gebotenen Kürze auf Ausschnitte begrenzen müsse, für Fragen aber zur Verfügung stehe. Er wolle sich auf die „rechtsextremen neonazistischen Gewaltnetzwerke seit den 1990er Jahren“ konzentrieren, weil es hier gefragt sei: vor allem in NRW, d.h. in Dortmund und Köln.
Dabei stütze er sich in seinen Ausführungen „auf die Ergebnisse von fünf Untersuchungsausschüssen“. An vier habe er als Sachverständiger teilgenommen. Darüber hinaus habe er eigene Recherchen vorgenommen. Weiterhin beziehe er sich auf Andrea Röpke, Rainer Fromm, Thomas Moser, Bernd Wagner sowie insbesondere auch auf die Anwält_innen der Nebenklage in München.
Zunächst geht Funke auf die Entwicklungen der extremen Rechten ein, die sich, wie Bernd Wagner feststelle, als „Gewaltbewegung“ nach der „Einigung“ 1989 „ungeheuer ausgedehnt“ habe. Aus eigenen Interviews mit Neonazis aus Jena – er betont, dass diese nicht angeklagt seien – wisse er, dass diese sich selbst als „braune Freiheitsbewegung“ gesehen hätten. Hier bekräftigt Funke die These, dass es mit der deutschen Einigung eine Generation gegeben habe, die „buchstäblich orientierungslos“ gewesen sei. In diesem Zusammenhang verweist er auf die soziologische Anomietheorie und auf Erschütterungen im Kontext der Wende: „Das hat zur Entgleisung von vielen Familien geführt“ und habe Orientierung zwischen dem „alten“ und dem neuen „Regime“ erschwert. Es habe einen „ungeheuren gesellschaftlichen Freiraum“ gegeben, der Räume für eine „Mischung von Spontanität und Organisiertheit“ eröffnet habe und durch Neonazi-Kader aus den neuen und alten Bundesländern „reinterpretiert“ worden sei.
Der Politikwissenschaftler geht im weiteren auf ein Netzwerk an Neonazis, „die sich zu größeren Teilen untereinander kennen“ ein. Funke bezieht sich dabei auf eine von ihm durchgeführte Studie über David Irving, die er als Sachverständiger im sog. „Londoner Prozess“ erstellt habe. Er habe dafür „alle Tagebücher von David Irving“ lesen können, die Teil der Prozessunterlagen gewesen seien. Am 9.11.1992 sei Irving „vor den versammelten Kleinstparteien der Neonazis aus Ost und West“ aufgetreten, darunter u.a. Ian Stuart Donaldson (Skrewdriver u. Blood&Honour), Christian Worch und Gottfried Küssel. Hier habe Irving den „großen Märtyrer des Friedens, Rudolf Heß“ beschworen. Die Anwesenden hätten mit „Sieg Heil“ geantwortet. Entscheidend sei hier die gegenseitige Bezugnahme und der Netzwerkcharakter gewesen: Ein Netzwerk von Leuten, die sich „zu größeren Teilen untereinander kennen“ – über Blood&Honour, Hammerskins, oder auch „Thomas G. und andere“.
Im anschließenden Punkt möchte Funke Sturm dort widersprechen, wo es um die ideologischen Grundbausteine und die Ausrichtung an Positionen des historischen Nationalsozialismus ginge. Denn er, Funke, sähe hier grundlegend ebenfalls eine ideologische Orientierung am historischen NS, diese jedoch in fundamentaler Verschärfung. Im Sinne einer „Zweiten Revolution“ (Michael Kühnen) sei es schon sehr wohl um das Ziel „SA-Staat“ gegangen. Man habe mehr sein wollen als „Adolf Hitler es gewollt hat“. Als leitende Vorstellung sei in diesem Sinne in Kühnens Schrift „Die Zweite Revolution“ eine „doppelte Aufforderung“ zur „ultimativen Radikalisierung“ enthalten, als „Erlaubnis, zu schlagen oder gegebenenfalls zu töten“, wie es Kühnens strategisches Gewaltkonzept vorsehe. Funke sieht hier ein gemeinsames Leitbild für die „Kadernetze“ von Blood&Honour, Hammerskins und Ku-Klux-Klan. Die Pogrome der 1990er Jahre (Rostock/Hoyerswerda) seien hier die „Fanale einer regelrechten faschistischen Bewegung“ gewesen, welche die „Quasi-Legitimität“ dieser „subkulturellen Gewaltbewegung“ angefeuert hätten.
„Das Fanal zog und zwar sehr schnell“ auch in NRW. Beispielhaft benennt Funke an dieser Stelle Hünxe, Köln-Worringen und weitere Anschläge, auf die NSU-watch und Lotta aufmerksam gemacht haben. Der Anschlag in Solingen sei als „fataler Höhepunkt“ allen bekannt. Funke verweist an dieser Stelle auch auf die politische Dimension der Änderung des Grundrechts auf Asyl.
In dieser Zeit habe es aber keinen gesellschaftlichen „Aufschrei“, keine „klare Kante“ gegeben. Und so hätten neonazistische Kader auch in NRW dies „als eine Art Freibrief verstanden“. Ohne dieses „gewaltbereite Milieu“ hätten sich die Szenen und Netzwerke in Köln und Dortmund „nicht so festigen können“. Hier schlägt Funke auch konkreter den Bogen zu den Tatorten und Akteuren in Köln und Dortmund. In Köln gehe es nicht nur um das „Aktionsbüro Mittelrhein“, sondern vielmehr auch um den „vielfach unterschätzten Kampfbund Deutscher Sozialisten“ (KDS). Funke nennt eine Reihe an Personen, die in diesem Kontext von Bedeutung seien: hier u.a. Axel Reitz, Johann H. und Thomas G. – und diese, so Funke, „hatten Kontakte und waren vernetzt auch mit dem Unterstützerkreis des NSU“.
Anschließend geht Funke etwas ausführlicher auf Thomas G. ein, den er unter Bezugnahme auf Andreas Förster als „Schlüsselfigur“ benennt. G. sei „KDS’ler“ und „Hammerskin“ aus Thüringen mit zahlreichen internationalen und bundesweiten Kontakten sowie „Ziehsohn“ des BfV-V-Manns Mirko H. Es sei bekannt, dass Thomas G. „bis zuletzt“ Kontakt zum NSU gehalten hätte. „Ein Alexander Larrass schreibt aus der Haft“, dass Thomas G. „Zellen aufgebaut habe“. Es folgt ein Verweis, dass G. „in enger Verbindung zur Kölner Szene gestanden habe“. Funke fährt fragend fort: „Was weiß Thomas G.?“ Und was die Sicherheitsbehörden über ihn wüssten, das in den bisherigen Untersuchungsausschüssen und im Münchener NSU-Prozess noch nicht bekannt geworden sei.
An Lüders und den Ausschuss gerichtet ergänzt Funke: „Vielleicht erfahren Sie auch mehr, wenn Sie das BKA fragen, das eine eigene Untersuchung über die Hammerskins im Jahre 2012 gemacht hat.“ Thomas G. fehle in dieser Untersuchung allerdings. Die Stimme erhebend fragt Funke: „Hatte er mehr als diese beiden Rollen des KDS’lers und des Hammerskins?“ Weiterhin benennt er die umfangreiche „umtriebige Vernetzung“ von Thomas G., dessen Bekanntschaft mit Ralf Wohlleben. Darüber hinaus solle der Ausschuss nach Johann H. fragen, „ausgebildet als Scharfschütze“ und vorbestraft wegen eines „Sprengstoffdelikts“. Fast schon süffisant gehen Funkes Fragen weiter: „Hatte Ronny W., ein Bombenexperte, ein Kennverhältnis mit Thomas G?“ , „Ist er [Ronny W.] immer noch aktiv hier in der Region?“, „Hat er Kontakte zur rechtsextremen Szene in Dortmund?“ Hatte er hierin eine Scharnierfunktion, „der Uralt-Kumpel von Uwe Mundlos?“
Appellativ an den Ausschuss gerichtet ergänzt Funke, dass der Ausschuss das BKA und BfV über Thomas G., zur Studie über die Hammerskins und zum ehemaligen V-Mann Mirko H. fragen solle. „Lassen Sie sich die Akten dazu ungeschwärzt geben!“
Nach diesen mahnenden Worten, geht Funke nicht nachlassend auf einen VS-Vermerk aus dem Februar 2012 zur „Ähnlichkeit des Phantombilds“ im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Probsteigasse ein, ohne jedoch den Namen von Johann H. zu nennen. Dieser Neonazi sei nach Mathilde Koller (bis 2012 des NRW-Verfassungsschutzes) „Funktionsträger der Kölner Kameradschaft Walter Spangenberg“ und im KDS gewesen. Funke: „Fragen Sie Frau Koller, die vorzeitig aus dem Amt geschieden ist“.
Anschließend macht Funke darauf aufmerksam, dass es laut Andreas Förster Material zur Keupstraße gebe (gemeint sind die Video-Aufzeichnung der Überwachungskamera am Gebäude eines Fernsehsender-Büros, Anm. d. Red.), das dem Bundes-Untersuchungsausschuss nicht zur Kenntnis gelangt sei. „15 Stunden Videomaterial und mehr“. Es seien „mehrfach die Szene eines Pärchens“ in der Nähe des Radfahrers bzw. des Fahrrad-Schiebenden zu sehen und das „identifiziert gehört“.
Weiter geht es mit der „Dortmunder Szene“, die Funke als „zweiten Hotspot“ – „neben vielen kleineren“ – in NRW beschreibt. Als Ausgangspunkt benennt Funke vor allem „Oidoxie“ sowie das Umfeld der „Streetfighting Crew“ um Marko G. „der gegenwärtig allerdings in Schweden ist, nach dem was ich höre“, wie Funke bemerkt. Es gebe durchaus auch heute noch personelle Überschneidungen zu den Leuten von damals.
Im Folgenden wirft Funke einige Schlaglichter auf, die den Tatort Dortmund betreffen. Sein Fokus ist zunächst ein personeller: Er nennt die „prekäre Rolle des V-Manns Sebastian S.“, „von Robin S. […], von Sven Oliver A., von Toni S. […], von Kurt-Otto S. und anderen“. Ein „wichtiger Strippenzieher des NSU-Unterstützerumfelds“ sei auch Thomas St. gewesen.
Funke führt aus, dass es enge Kontakte der Dortmunder Szene nach Kassel und zum „Sturm 18“ gegeben habe. „Das lief über Sebastian S.“, der Funke zufolge auch Kontakte nach Belgien hatte. Der Sachverständige macht darauf aufmerksam, dass es derzeit einen Prozess in Belgien zu „Combat 18“ (C18) gebe, aus dem möglicherweise Erkenntnisse über die Bedeutung der Dortmunder Strukturen hervorgehen könnten. Des weiteren habe der „gewalttätige Rechtsextremismus“ eine Szene hervorgebracht, die sich „gekannt, radikalisiert und vernetzt“ habe als „immer mehr bundesweit terrorbereite Gruppen“. Funke nennt hier insbesondere nochmals die Netzwerke und Kaderstrukturen von B&H/C18, Hammerskins und Ku-Klux-Klan (KKK).
„V-Leute waren nicht immer hilfreich“, schließt Funke hier an. Er fordert, „dieses System zu überprüfen“. Aber auch der Verfassungsschutz an sich müsse kritisch thematisiert werden. Denn er habe, wie der Sachverständige Winfried Ridder ausgeführt habe, „strukturelle Probleme und Kooperationsprobleme“. Weiterhin geht Funke auf die Dissertation von Martin Thein, ehemals Mitarbeiter im „Rechtsextremismus-Referat“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ein. Thein sei letztlich zu einer Fehleinschätzung gekommen, wenn er „leitmotivisch“ zu dem Schluss komme, dass die Gewaltphase abgeschlossen sei, die Szene „der Gewalt abgeschworen“ hätte. Eine „Fehlwahrnehmung“ allemal, „vielleicht ein tödlicher Irrtum“ des Bundesamtes, wie Funke scharf bemerkt. „Das könnte dazu beigetragen haben, dass man etwas nicht gesehen hat, was man hätte sehen müssen“, so Funke wörtlich. Hieraus könnten sich auch Konsequenzen für eine „unabhängige Kontrolle“ und „öffentliche Kritik“ von Institutionen wie dem Verfassungsschutz ergeben. Funke fordert hierzu abschließend, auch Schutzmaßnahmen für „Whistle-Blower“ zu überdenken.
Entscheidend sei, dass die Szenen weiter bestünden und vernetzt seien: durch Einzelne, aber auch durch Organisationen wie B&H und Hammerskins. Es ist laut Funke zu überprüfen, ob sie mehr zu den Morden beigetragen haben als bisher bekannt. Das Beispiel Heilbronn zeige, dass „sehr sehr viel“ dafür spreche. Abschließend geht Funke noch auf neuerliche Diskurse um Asyl und Flüchtlinge „im Schatten“ des Rechtspopulismus ein und hofft, dass der Ausschuss einen Beitrag „zur Sicherheit der von Ihnen vertretenen Menschen“ leisten wird.
Applaus und Klopfen der Zuhörenden für den ausführlichen Beitrag Funkes.
Nadja Lüders bedankt sich und kommentiert die Anmerkung Funkes zur Fülle der Fragen und bemerkt, dass der Ausschuss „weitere Fragen für unseren Auftrag“ entwickeln müsse. Sie schließt: „Wir wollen hoffen, dass wir das auch zeitlich hinbekommen“. Dann bittet Lüders Prof. Dr. Juliane Karakayali um ihr Eingangsstatement.
Karakayali dankt für die Einladung und verweist darauf, dass ihr Beitrag sich auf gesamtgesellschaftliche Phänomene beziehe und sie nicht explizit, wie ihre Vorgänger, über die extreme Rechte sprechen würde. Ihr Auftrag laute „über die Reaktionen der deutschen Gesellschaft auf die Entwicklung der extremen Rechten seit 1990/91“ zu sprechen. Im Folgenden wolle sie sich mit rassistischen Diskursen der Mehrheitsgesellschaft und der migrantischen Perspektive, insbesondere der türkischen Community, beschäftigen. Sie wolle thematisch den „Bogen von den Erfahrungen der Migrantinnen und Migranten zu Beginn der 1990er Jahre bis hin zu den Morden des NSU“ schlagen.
Im Folgenden skizziert Karakayali migrationspolitische Eckpfeiler der BRD seit Beginn der 1990er Jahre. Migrant_innen hätten nach der Wende die Erfahrung gemacht, „nicht Teil dieser neuen deutschen Gesellschaft zu sein“. Alle Migrationsabkommen der DDR seien gekündigt worden. Für Migrant_innen in den neuen Bundesländern sei dies gleichbedeutend mit Verlust der „Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis“. Auch Karakayali geht auf die Pogrome und die rassistische Stimmung in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung ein.
Die Ausschreitungen und Übergriffe von „Hoyerswerda, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Lübeck stehen als Symbole für dieses beängstigende Kapitel der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands“. Problematisch sei nicht nur die neonazistische Gewalt gewesen, sondern die politische und mediale Ausgrenzung. Sie erinnert an den SPIEGEL-Titel „Das Boot ist voll“.
In der Folge sei der rechte Terror nicht verurteilt, sondern als Argumentation für die Verschärfung des Asylrechts herangezogen worden. Die Bezugnahme der Politik auf den „rassistischen Terror“ sei durch den Journalisten Jochen Schmidt für die Ereignisse und Folgen von Rostock-Lichtenhagen bestätigt worden. Deutschland habe in der Folge immer wieder betont, „kein Einwanderungsland“ zu sein. Über das Kriterium der Staatsangehörigkeit sei der „Zugang zu Rechten und zu Ressourcen geregelt“ worden. Manifestiert habe sich dies in eigenen Gesetzen und Regelungen sowie in Sanktionen wie der Option auf Ausweisung. Eine Änderung für nicht EU-Bürger_innen sei erst durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 2000 erfolgt, so Karakayali.
Durch die Reformierung habe es eine „Zäsur“ gegeben, die faktisch bedeute, dass „Deutschland ein Einwanderungsland“ sei. Der Status von Migrant_innen sei hierdurch verbessert worden und Karakayali meint, dass hier „zum ersten Mal eine Akzeptanz einer pluralen Bevölkerung“ zum Ausdruck gekommen sei, die jedoch nicht von allen Teilen von Politik und Gesellschaft anerkannt wurde. Dieses Ringen um Akzeptanz sei „politisch äußerst umkämpft“ gewesen und es sei gewissermaßen ein „Gegenangriff“ gefolgt, welcher „diese Selbstverständlichkeit wiederum in Frage“ gestellt habe. Im Zuge dessen seien rassistische Kampagnen gestartet und die Debatte um eine „neue Leitkultur“ entzündet worden. Begleitet worden sei diese Phase von zunehmendem Rassismus und Gewalttaten. Beispielhaft für NRW nennt die Referentin den Anschlag auf Migrant_innen in Düsseldorf-Wehrhahn (2000). Der Anschlag habe eigentlich einen „Wendepunkt“ markiert, da es in der Folge zum ersten Mal Anerkennung und Problematisierung von Rechtsextremismus als Bedrohung gegeben habe.
Karakayali fährt fort und beschreibt, dass eine Beschäftigung mit dem Thema des gesellschaftlichen Ausschlusses von Migrant_innen jedoch ausgeblieben sei. An dieser Stelle führt Karakayali den Begriff des Rassismus ein, der wissenschaftlich nicht „als individuelles Vorurteil, sondern als ein gesellschaftliches Verhältnis“ verstanden werde. Insbesondere im Kontext des PUA sei dies relevant, da der Blick auch auf institutionellen Rassismus gelenkt werden müsse.
Karakayali kritisiert, dass sowohl der Begriff in dieser Breite ebenso wie die Rassismusforschung „in Deutschland nicht sehr weit verbreitet“ seien.
Es folgt ein Exkurs in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Problematik des Rassismus am Beispiel des Zugangs zu Bildungschancen in Deutschland. Karakayali geht hierzu auf damit einhergehende Diffamierungen ein, z.B. darauf, dass Mehrsprachigkeit als kulturelles Defizit gesehen werde.
Ein weiterer Punkt, den die Sachverständige anspricht, ist der Hinweis auf Konjunkturen sich verbreiternder Vorurteile und Stigmatisierungen insbesondere seit dem 11. September 2001. In der Folge habe es viele „politische Debatten und Maßnahmen“ gegeben, die sich ganz ausdrücklich und negativ auf türkische bzw. muslimische Migrant_innen bezogen hätten. Karakayali nennt Beispiele und verweist auch auf die „groß[e]Beliebtheit des Buches von Thilo Sarrazin“: Aus Sicht der Migrationsforschung seien hiermit auch viele politische Debatten verknüpft (u.a. die „Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft“, die „Leitkulturdebatte“ (2000), die „Kopftuchdebatte“ (ab 2003), die „Debatte um Zwangsehen“ (2006), der sog. „Muslim-Einbürgerungstest“ in Baden-Württemberg (2006) und die Diskussionen um den Begriff der „Parallelgesellschaften“). „Alles das fand zwischen 2000 und 2006 statt – in den Jahren also, in denen der NSU gemordet hat“, so Karakayali.
Karakayali verdeutlicht im Folgenden nochmals, dass Rassismus sich nicht ausschließlich durch Angriffe von Neonazis zeige. Sie verweist auf Studien zur Diskriminierung türkischer/muslimischer Menschen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und bezieht sich hier explizit auch auf die Ergebnisse der bekannten Einstellungsstudien, etwa die Heitmeyer-Studie zu „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ sowie die „Mitte“-Studien (der Universität Leipzig, Anm. d. Red.) oder die Studie der Bertelsmann-Stiftung („Strategien gegen Rechtsextremismus“, Anm. d. Red.).
An dieser Stelle leitet Karakayali zum Thema NSU über. Die „Opfer des NSU“ seien „Kleingewerbetreibende“ gewesen, die in dieser Rolle für das „migrantische Unternehmertum“ stünden. Dass die Morde an den Migranten „über 11 Jahre lang für die Öffentlichkeit nicht eindeutig“ gewesen seien, habe mit dem „gesamte[n]gesellschaftliche[n]Wissen um kulturell differente Migranten“ zu tun. Und dies spiegele sich eben in den rassistischen Zuschreibungen und Verknüpfungen von Herkunft und Kriminalität wider. Die Sachverständige nennt in diesem Zusammenhang den lenkenden Ausdruck „Döner-Morde“, an den sich sicher alle gut erinnerten.
Diese Verknüpfung gelte sowohl für die Medien als auch für die Politik und die Sicherheitsbehörden. Dass Opfer und Angehörige selbst verdächtigt worden seien – und nicht die Täter –, sei insofern Zeichen dafür, dass die „mörderische Politik“ des NSU in dessen Logik durchaus „erfolgreich“ gewesen sei. Denn die Morde seien im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen. Es habe kein nachhaltiger Druck auf die Ermittlungsbehörden aufgebaut werden können, da sich die Gesamtgesellschaft ganz offensichtlich durch den Serienmord an Migranten nur wenig angegriffen gefühlt habe. Dies wirke bis heute weiter, da der Eindruck entstehe, dass das Interesse an der Aufklärung des NSU-Komplexes – abseits der PUA – nachlasse. Nicht zuletzt habe der NSU-Komplex das „Vertrauen insbesondere auch der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in den deutschen Staat […] nachhaltig erschüttert“. Es sei wissenschaftlich nachvollziehbar dargestellt, dass Migrant_innen nicht darauf vertrauten, dass die NSU-Mordserie aufgeklärt würde. Dazu gebe es in der mirgantischen Community durchaus die Erfahrung der Verbindung von Gewalt und Rassismus, sodass „vielen Angehörigen unmittelbar nach den Taten klar war“, dass Rassismus höchstwahrscheinlich das Tatmotiv gewesen sei.
Ein wichtiger Baustein zur Aufklärung sei daher die Auseinandersetzung mit solchen „Ausgrenzungspraktiken“. Karakayali: „Ein wichtiger Schritt hierfür wäre insbesondere die Diskriminierung in Institutionen abzubauen“. Damit verbunden erwähnt die Sachverständige abschließend die „von verschiedenen Antidiskriminierungsinitiativen geforderten unabhängigen Beschwerdestellen“ etwa für Polizei und Justiz. Dies könne „sicherlich ein probater Anfang sein,“ so Karakayali.
Nadja Lüders dankt der Referentin für ihre Ausführungen und erklärt, dass sie persönlich nun von „dem Input ein wenig erschlagen“ sei. Sie erteilt daher direkt der CDU-Fraktion das Wort und eröffnet die Fragerunde.
Heiko Hendriks (CDU) merkt an, dass er froh sei, „dass es ein Wortprotokoll geben wird“, und dankt im Namen der CDU-Fraktion für die Ausführungen. Seine Frage richtet sich an die Sachverständigen Sturm und Funke, deren Ausführungen er für sich als „spannend und interessant“ einordnet. Er glaube, eine „Übereinstimmung“ beider Statements zu erkennen, die er erfragen bzw. klären möchte. Er wendet sich direkt an die beiden Sachverständigen: „Für Sie beide ist das, was passiert ist überhaupt keine Überraschung, sondern fast eine natürliche Folge aus einer Entwicklung nach 1990, dass so etwas passiert?“ Er selbst sei „punktuell anderer Meinung“ als die Sachverständigen, wolle jedoch wissen, ob aufgrund des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes die Existenz von rechtem Terror hätte erkannt werden müssen.
Im Anschluss möchte er noch eine weitere Frage klären, die er als wesentlich erachtet, da nicht alle Parlamentarier_innen eine Vorbildung, „was Rechtsextremismus angeht“, hätten. So wolle er besprechen, dass es nach „all den Erfahrungen, die gemacht worden sind“, doch eigentlich nicht sein könne, „dass wir hier von drei Personen“ redeten. „Vielmehr müssen wir von einer Vernetzung, Verquickung ausgehen,“ so Hendriks. Er bittet Funke hier noch einmal um einen eindeutigen Hinweis, ob er ihn, Funke, an dieser Stelle richtig verstanden habe und dieser das als eindeutige erachte. Hendriks hat eine weitere Frage an Funke und beginnt, sie zu formulieren.
Lüders unterbricht kurz und sagt, dass der Ausschuss sich „eigentlich“ auf eine Frage pro Fraktion und Fragerunde geeinigt habe. Hendriks betont, dass seine Frage „für uns relevant“ sei. Lüders erwidert sinngemäß, dass die anderen dies von ihren Fragen sicher auch glaubten.
Hendriks fährt jedoch unbeirrt mit seiner Frage fort und bemerkt „Ich stelle danach keine weiteren Fragen mehr“. Es folgt kurzes Gelächter im Saal. Hendriks Frage an Funke bezieht sich dann auf dessen Erfahrungen mit anderen Ausschüssen, hier ganz konkret auch auf die Zusammenarbeit der Ausschüsse mit den „Sicherheitsbehörden“. Hendriks: „Wie schätzen Sie die Kooperationsbereitschaft der Sicherheitsbehörden zur Aufklärung dieser Fragen generell ein?“
Funke: „Mit der letzten, der schwierigsten Frage fange ich an“: Am Beispiel des PUA in Baden-Württemberg macht Funke in der Folge deutlich, dass sich „das Verhalten der Sicherheitsbehörden“ in dem Maße ändere, wie deutlich signalisiert würde, dass der Stuttgarter Ausschuss „entschieden, konsequent alles wissen will und alle Akten haben will und dies ihm zugesichert ist“.
Funke formuliert den Eindruck: „Es hängt tatsächlich von Ihrem politischen Willen und Ihrer Durchsetzungskraft ab“. In Thüringen sei das aufgrund des Skandals um Tino Brandt von Beginn an ganz anders gewesen. Brandt werde als Quelle immer noch geschützt, „obwohl schon klar war, dass er über ungefähr sieben Jahre vom Verfassungsschutz gestützt den THS (Thüringer Heimatschutz, Anm. d. Red.) ausbilden und ausweiten konnte“. Dies habe dazu beigetragen, dass ein Druck entstanden sei, den Dorothea Marx (SPD) habe nutzen können, um „sehr weit vorzudringen“, auch wenn der PUA letzten Endes nicht „alles erfahren“ habe. Laut Funke sei die Kooperationsbereitschaft sehr unterschiedlich entwickelt bzw. „unterentwickelt“.
Bevor Funke auf die weiteren Fragen eingeht, übergibt er das Wort erst einmal an den Sachverständigen Sturm.
Sturm geht auf die Frage der CDU-Fraktion nach dem „Überraschungsmoment durch rechtsextreme Gewalt“ ein. Sturm bezieht sich hier wiederum auf seine historische Einführung zu den 1970er Jahren. Es habe sowohl „Rechtsterrorismus“ als auch „militante Straßengewalt durch Neonazis“ gegeben. Diese Entwicklungen in der extremen Rechten seien nicht unbedingt in physischer Gewalt manifestiert gewesen, aber die „Option der Gewalt“ habe es immer gegeben. Eine Besonderheit sieht Sturm darin, dass sie keiner Legitimation unterlegen habe und nicht begründet worden sei. In der Linken sei dies ganz anders gewesen. Hier habe es „jahrzehntelange Debatten“ darüber gegeben, ob und wie Gewalt zu legitimieren sei. Beim Rechtsextremismus finde dieser Diskurs nicht statt. „Gewalt wird praktiziert, oder sie wird nicht praktiziert.“ So sei Gewalt eine akzeptierte Form von Handeln bei Neonazis, „ein legitimes Feld politischen Handelns“. Konsequenz daraus sei, dass häufig dazu übergegangen werde, eine Tat als unpolitisch zu etikettieren, wenn keine Motive ersichtlich, keine Bekennerschriften bekannt seien. Genau dieses Wissen um bekenntnislose rassistische Gewaltakte sei zur Einordnung von rechtsextremen Straftaten erforderlich.
Funke ergänzt, dass es hierfür hilfreich sei, sich mit der Ideologie auseinander zu setzen und empfiehlt wiederum Michael Kühnens „Die Zweite Revolution“ mit Worchs Vorwort zur Lektüre. Darüber hinaus verweist er auf einen Text von André Eminger („White Pride“). Funke: „Da haben sie […] die ideologische Folie […] in verschiedenen Versionen. Und es ist so radikal, wie man sich das kaum vorstellen kann.“
Zur zweiten Frage Hendriks‘ fasst Funke zusammen: „In der Tat spricht alles für Vernetzung“. Der beste Beleg hierfür sei seiner Ansicht nach „Heilbronn“. Funke erläutert im Folgenden Anhaltspunkte wie Phantombilderbeschreibungen von Zeug_innen (etwa am Heilbronner Tatort Theresienwiese) und den Umgang mit ihnen und anderen Ermittlungswegen, die eine bestimmte „Mentalität in einer ganzen Reihe von Sicherheitsbehörden“ sichtbar mache, „nicht auf rechts zu schauen“. Weiterhin geht Funke auf die Konsequenz ein, die es nach sich ziehe, im Umfeld der Opferfamilien zu ermitteln. Er habe diese Ermittlungsrichtung bis heute „nicht verstanden“ und habe darum sehr genau zu untersuchen versucht, „womit das zu tun hat“, dass es eine solche Einseitigkeit der Ermittlungsrichtungen gegeben habe. In diesem Kontext habe er sich auch mit der „BAO Bosporus“ (Besondere Aufbauorganisation, Anm. d. Red.) auseinander gesetzt. Deren einseitigen Ermittlungswege hätten dazu geführt, „rechtsextreme Spuren abzuwerten“. Die zweite OFA (Operative Fallanalyse, Anm. d. Red.) der „BAO Bosporus“ eines Münchner Psychologen sei sofort „weggenommen“ und durch eine baden-württembergische ersetzt worden. Deren Argument: „So ein furchtbares Verbrechen kommt in unserem Kulturkreis nicht vor“. Die Problematik sei offenkundig („Sie haben da dicke Probleme“) und Funke fordert „eine Fehlerkultur“ zu entwickeln. Die Probleme würden schließlich im anhaltenden Schubladendenken nicht kleiner.
Zur dritten Frage konstatiert Funke, dass es für viele „natürlich“ eine Überraschung gewesen sei, dennoch sei auch er (in „Paranoia und Politik“, 2002) von einem „Terrorpotential“ ausgegangen. Letztlich gesehen habe aber auch er die Dimensionen nicht. Weiterhin meint Funke, dass auch er einen „Mindestglauben“ an die Sicherheitsbehörden gehabt habe. Otto Schily habe ihm gegenüber eingeräumt, Fehler gemacht zu haben. Schily habe einmal informell zu ihm gesagt: „Wir hätten den Fahndungsdruck erhöhen müssen und zwar offen in alle Richtungen“. Funke erzählt weiter – betonend, dass er das ebenfalls „nicht als Zeuge“ sage –, dass er ein Gespräch mit „einem alten Freund“ aus dem BKA, den er „irgendwo in Südamerika kennen gelernt“ habe, ein Gespräch geführt habe. Er zitiert ihn: „[…] ich hab denen […] gesagt: ‚Guckt doch mal rechts‘. Da haben die nur gegrinst […].“ Sodann resümiert Funke hierzu: Es habe „eine Mentalität, es nicht wissen zu wollen in dieser Richtung“ gegeben. Und das, so Funke, „muss anders werden.“
Nadja Lüders bittet Andreas Kossiski um seine Frage.
Andreas Kossiski (SPD) bedankt sich auch für die Ausführungen und möchte in Bezug auf die „Generation Rostock“ wissen: „Inwieweit haben diese Anschläge […] der früheren 1990er Jahre Einfluss auf die weitere Entwicklung gehabt?“ Was dies für die heutige Entwicklung bedeute? Ob das Gewaltpotential gestiegen sei? „Sind die Taten des NSU“, so Kossiski fragend, „eine besondere Form dieser Gewalt oder ist das eine logische Konsequenz?“. Auch Kossiski richtet seine Fragen „an die beiden Herren“.
Sturm antwortet, Rostock-Lichtenhagen sei ein Schlüsselereignis gewesen.
Die Neonazis hätten den Eindruck gehabt (Sturm zitiert fiktiv): „Was wir machen, ist eigentlich das, was der Volkswille zum Ausdruck bringt“. Dadurch wäre für sie der Eindruck entstanden, „Massen hinter“ sich zu haben. Auch heute würde Rostock als eine „Art Erinnerungsort“ eine wichtige Bedeutung haben.
Historische Referenzen seien ansonsten meist auf den NS oder die 1920er und 30er Jahre bezogen (Horst Wessel oder Albert Leo Schlageter z.B.). Nach 1945 hätten die Neonazis „kaum Orte gefunden […], auf die sie sich beziehen“ könnten. Das „Sonnenblumenhaus“ in Rostock sei jedoch ein solcher. NPD-Leute ließen sich etwa noch heute vor dem Gebäude fotografieren. Es gebe dadurch eine Art Dokumentation der „Geschichte eigener Wirkungsmächtigkeit“.
In Bezug auf konkrete Gewaltformen wagt Sturm keine Vorhersagen. Der Sachverständige betont jedoch, dass Gewaltbereitschaft, Terrorismus bis hin zum Mord immer als Option mitgedacht würden. Dass es keine Tabuisierung solcher Taten gebe, zeige u.a. das Beispiel Michael Bergers in Dortmund. Nach der Tat hätte sich die örtliche Szene im Gegenteil sogar solidarisiert und den Mörder gefeiert. Er sei eine Figur, die offenbar „vollkommen kritiklos“ als „Vorbild“ gelte. Aufgrund der fehlenden Diskussion über die Legitimität von Gewalt innerhalb der extremen Rechten, sehe Sturm kein Ende der Bedrohung durch Terror von rechts.
Funke meint, es sei jedoch auch durchaus ein „taktisches Verhältnis zu Gewalt“ wahrnehmbar, etwa bei der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. In Rekurs auf Jochen Schmidts Arbeit und auch Funkes eigene Thesen in seinem Buch „Brandstifter“ meint Funke, Rostock-Lichtenhagen sei ein von Stadt, Land und „indirekt auch vom Bund“ „bewusst zugelassenes Pogrom“ gewesen. Es habe dort auch V-Leute, bzw. spätere V-Leute gegeben. Wie Hünxe, Mölln und Hoyerswerda sei auch Rostock ein „Fanal“ gewesen, also „West wie Ost“.Hier seien die „Kader“ wichtig gewesen, deren Bedeutung er jedoch stärker akzentuieren wolle als Sturm: Diese – Funke nennt explizit Christian Worch und Michael Kühnen – hätten in den Pogromen eine „nationalrevolutionäre Chance“ gesehen im Sinne des „ideologischen Glaubens und Tatglaubens“. Die Entwicklung in den frühen 1990ern sei 1993 auf einem Höhepunkt gewesen. Im Verlauf der 1990er habe rechte Gewalt stagniert, dies aber auf einem hohen Niveau. 2000 hätte es, so Funke, „eine kleine Unterbrechung und eine leichte Abschwächung gegeben“, da sich der „Aufstand der Anständigen“ stark gemacht habe. Funke ergänzt im Wortspiel: „Es fehlt der Anstand der Zuständigen“. Im Saal gibt es Gelächter.
Seitdem gebe es, fährt Funke fort, ein heute hohes, „wenn auch stagnatives Niveau“, begünstigt durch „die Ausweitung […] der rechtspopulistischen Chancen“, ein nun „neues Herausforderungsausmaß“ und „Gefahrenpotenziale durch terroraffine Netzwerke“. Es sei „völlig klar“, dass solche terroraffine Netzwerke „unter uns“ seien. Funke: „Sie laufen zum Teil frei herum“. Dazu kämen „Mischszenen“, insbesondere im Bereich OK (Organisierte Kriminalität, Anm. d. Red.). Funke nennt hier Beispiele aus dem Bereich der Betäubungsmittel-/Drogen-Kriminalität im Verbund mit extremer Rechter in Thüringen und Sachsen, aber auch in Baden-Württemberg.
Lüders erteilt Verena Schäffer das Wort.
Verena Schäffer (GRÜNE) schließt mit ihren Fragen an die Ausführungen von Juliane Karakayali an. Ihr seien deren Ausführung zu den Wechselwirkungen der Migrations-Politik in der BRD von 2000 bis 2006 – ob Deutschland ein Einwanderungsland sei und auch „das politische Bekenntnis dazu“ – und den Morden und Anschlägen des NSU in genau diesem Zeitraum nicht bewusst gewesen. So richtet sie an alle drei Sachverständige die Frage, wie von der extremen Rechten eigentlich auf diese Debatte“, die es Anfang der 2000er Jahre in Deutschland gab, reagiert wurde. Wie war die Reaktion der extremen Rechten auf das politische Bekenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, will sie wissen.
Die drei Sachverständigen reden kurz, sprechen sich ab und lachen.
Sturm antwortet zuerst. Er meint, es gebe, wie er ausgeführt habe, innerhalb der extremen Rechten kaum ideologische Debatten. Es habe aber sehr wohl „Akzentverschiebungen“ darüber gegeben, welche Themen als „besonders favorisiert“ oder als zurückzustellende gesehen worden seien. Thema sei bis 1990 so etwa der Antikommunismus gewesen. In der Wendezeit sei dann Rassismus zentral geworden. Als Beispiel für ein Pogrom in Westdeutschland spricht Sturm noch Mannheim an, wo es 1992 eine „ähnliche Konstellation“ gegeben habe, „wo sich über Tage hinweg“ ein rechter Mob vor einer Geflüchteten-Unterkunft versammelt habe.
Der Sachverständige erläutert weiter, dass es Mitte der 1990er Jahre eine ideologisch aufgeladenere Sprache der „bewegungsorientierten Rechten“ gegeben habe, in der „völkisch-antikapitalistische Parolen“ und völkische Argumentationen aufgetaucht und stärker gemacht worden seien. Wesentlich sei hier der sogenannte „Kampf gegen das System“ gewesen. Mit diesem Schlagwort seien v.a. antisemitische und antiamerikanische Stereotype bedient worden. Diese Ideologie sei „ins Zentrum“ gestellt worden, die Debatten um Asyl seien in den Hintergrund gerückt. In diesem Kontext verweist Sturm auf Demonstrationsanlässe wie den 1. Mai oder den Jahrestag der Bombardierung Dresdens. Mit PEGIDA sei der offenkundige Rassismus wieder zurück.
Funke ergänzt, dass er die Erfahrung gemacht habe, dass: „Je weniger man in öffentlichen Debatten dagegen hält, desto größer [sei]der Spielraum“. Latente Fremdenfeindlichkeit stelle eine erhebliche Gefahr dar, weil die Rechtsextremen eine Gelegenheit sähen, sich ausweiten und radikalisieren zu können.
Zur Ideologie merkt Funke ferner an: „Es gibt natürlich ideologische Akzentuierungen und Debatten“, etwa im KDS, dem „Kampfbund Deutscher Sozialisten“ und dessen Ideen zu völkischem Nationalismus, Nationalbolschewismus und nationalem Sozialismus in der Tradition Ernst Niekischs. Kernideologie der Neonazis sei immer noch der Antisemitismus. Die „Kampagne“, so Funke weiter, gehe „im letzten Jahrzehnt aber vor allem gegen Migranten“. Funke nennt hierzu das Beispiel der NPD und ihres „Rückführungsprogrammes“. Heute gehe es gegen Asylflüchtlinge, „überhaupt gegen die anderen und die Fremden“. Ein solches „Programm“ – und hier verspricht sich Funke in seinen Ausführungen – sei „in der ganzen Breite und Intensität auf ihren Anspruch auf eine Vierte Republik – äh, auf ein ‚Viertes Reich‘ gerichtet.“
Karakayali ergreift das Wort und geht ebenfalls u.a. auf PEIGDA ein. Sie beschreibt, dass es nicht möglich sei, eine Trennung zwischen rassistischem Terror und rassistischen Diskursen zu machen.
Lüders bittet Joachim Stamp um seine Frage.
Joachim Stamp (FDP) betont, er wolle – strikt nach Geschäftsordnung – nur eine Frage stellen. Er merkt an, dass er der Auffassung sei, dass es notwendig sei, „dass man Debatten zu diesen Themen (er nannte zuvor etwa „das Kopftuch“ oder die doppelte Staatsbürgerschaft, Anm. d. Red.) führen kann“. Die Frage sei eher: „wie man sie führt“, ob „ressentimentgeladen“ oder „an der Sache orientiert.“ Aus diesen Ausführungen heraus formuliert er die Frage, wie man aus Ihrer Sicht Debatten führen muss. Stamp wendet sich dabei an Juliane Karakayali.
An Funke richtet Stamp seine eigentliche Frage, bezüglich des Prozesses in Belgien: Er bittet Funke, „noch näher“ darzustellen, „worum es da im Einzelnen geht und wo Sie für uns Anknüpfungspunkte sehen“?
Lüders erkundigt sich bei Stamp, ob es sich bei dessen „erste[r]Frage“ nun „tatsächlich um eine Frage oder nur [um]eine Anmerkung“ handele. Im Saal gibt es Gelächter.
Stamp bemerkt, dass ihn seine Ausführung über die Debatten-Kultur ad hoc auf den Gedanken gebracht hätten, die Sachverständige Karakayali hier um „einen Satz dazu“ zu bitten.
Karakayali antwortet, es sei nicht ihr Ziel gewesen, Tabuthemen zu benennen. Es gehe darum, dass einige Debatten jeglicher Grundlage entbehrten, wie beispielsweise die Debatte um Zwangsehen. Solche Themen dienten der Instrumentalisierung und der Legitimation, das Migrationsrecht zu beschränken. Es werde eine Politik der Angst betrieben, zu Lasten der Migrant_innen.
Funke merkt an, viel könne er zu dem Prozess nicht sagen. Er sehe Zusammenhänge in Bezug auf die Person Sebastian S. (Seemann, Anm. d. Red.) aus der Dortmunder Szene.
Lüders erteilt Birgit Rydlewski das Wort.
Birgit Rydlewski (Piraten) fragt, an Sturm gewandt: „Gibt es Beispiele für rechtsterroristische Anschläge, Taten, Aktionen mit Bekennerschreiben? Hat es das jemals gegeben, so dass man also auf die Idee kommen könnte, zu sagen: ‚Wir konnten das nicht wissen?‘“
Sturm: Abgesehen von dem „Manifest“ von Anders Breivik, seien ihm in der Geschichte des westdeutschen Rechtsterrorismus keine Schreiben bekannt. Es finde keine „ideologische Begründung“ statt. Es gebe jedoch „Äußerungen“, Flugblätter oder Parolen, mit denen auf die Taten Bezug genommen werde. Als Bespiel nennt er Manfred Roeder und die „Deutschen Aktionsgruppen“. Auch zu deren Sprengstoff- und Brandanschläge gebe es keine Bekennerschreiben, wohl aber Äußerungen von Manfred Roeder. Und auch im NSU-Prozess sei dies erkennbar. Dieser werde nicht als „Forum für eine mögliche politische Agitation genommen“. Strategie sei hier vielmehr, nichts zu sagen und die „Taten weiter für sich“ stehen zu lassen. Bezüglich der Sicherheitsbehörden, zu denen Rydlewski nach einer Erklärung gefragt hatte, warum diese hätten sagen können, man hätte einen rechtsterroristischen Hintergrund nicht ahnen können, kritisiert Sturm deren Ausrichtung auf linke Gewalt.
Funke ergänzt: „Es gibt schon Hinweise“ in Form von „Bekennerparolen“ (z.B. in Düren mit der „Bildparole“ und der Botschaft an die muslimische Gemeinde: „Ihr seid als Nächstes dran.“). Ein anderes Beispiel: Andrejewsi, „der Rechtsextreme, der nach meinem Kenntnisstand […] irgendwann V-Mann gewesen ist“, habe 1992 „sehr direkt“ vor Pogromen gewarnt. Das „hatte was von: ‚Wir warnen euch!‘“. Dies und andere Ereignisse „hätte[n]natürlich auch für Behörden signifikant sein können“.
Funke betont in Bezug auf die Ermittlungsarbeit gegenüber Tatverdächtigen, dass „die, die was verstecken müssen“ auch Schwachstellen hätten. Wörtlich: „Wenn Sie jemanden grillen wollen, tun Sie es vier Stunden, und er sagt Ihnen etwas, was Sie vorher nicht erwartet haben.“ Funke erzählt in diesem Zusammenhang von einem Verhör in Baden-Württemberg.
Darüber hinaus meint er, dass Bundesamt habe den NSU auf ein „singuläres Ereignis“ reduziert. Der „Kern der Sicherheitsbehördenproblematik“ beim Verfassungsschutz sei, dass es keine interne analytische Debatte „über das, worum es geht“ gebe. Kurz nach dem Mord an Enver Şimşek habe es eine „intensive Debatte“ auf Leitungsebene diverser Sicherheitsbehörden gegeben, ob man „die Gefahr des Terrors […] zu einer operativen Strategie machen sollte“. Die Leitungen der Sicherheitsbehörde hätten sich „mehrheitlich, sehr demokratisch, entschieden, das nicht zu tun.“
Lüders greift Funkes Bemerkung zum ‚Erfolg‘ langer Verhöre auf: „Herr Professor Funke, wir haben das mit den vier bis fünf Stunden für unsere nächsten Sitzungen notiert“.
Funke: „Ich komme wieder!“ Im Saal gibt es Gelächter.
Lüders: „Nicht nur dafür, auch für die Raumbuchungen. Denn jetzt wissen wir, wie lange wir die Räume für die Zeugenvernehmungen brauchen, damit die Vernehmungen auch fruchtbar sind.“
Bernhard von Grünberg (SPD) hat das Wort: Er habe ein Buch gelesen, welches 2008 veröffentlicht worden sei, in dem stand, es habe bis 2008 140 Morde durch Rechte gegeben. Es müsse da auch Prozesse gegeben haben. Im Mainstream habe darüber aber keine Diskussion stattgefunden. Von Grünberg formuliert seine Frage: „Wie ist das eigentlich jetzt?“ Heute werde ja „mainstream-mäßig innerhalb der Verfassungsschutzbehörden über „islamische Gefährdung“ gesprochen. Sei da nicht auch nach der rechten Szene zu fragen, die angesichts der „islamischen Gefährdung“ eigentlich doch „richtig aufrüsten“ müsste. „Wird da wieder nicht hingeguckt?“
Funke antwortet, dass er den Prozess wegen der Hetzjagd in Guben besucht habe. Und auch andere Beispiele (Mügeln etwa) zeigten, dass die Nebenklage durchaus Aufklärung wolle. Es habe jedoch eine Verteidigung gegeben, die gesagt habe: „Die waren alle nicht so schlimm“. Die Folge seien milde Urteile gewesen und die Rolle des Staatsanwaltes sei kritisiert worden. Es gebe jedoch auch eine Reihe von Prozessen, die keine Aufmerksamkeit erlangten. Der Skandal sei indes nicht vorbei, solange es „nicht wirklich entscheidende Konsequenzen in den Sicherheitsbehörden und auch in der Eindämmung […] rassistsich motivierter Gewalt“ gäbe. Man müsse auf einem „Ende der Kompromissbereitschaft“ bestehen, um Abwertung und Rassismus vorzubeugen. Dennoch dürfe auch eine sogenannte „islamische Gefährdung“ nicht negiert werden.
Funke betont aber, dass es für ihn eine „islamische Gefährdung“ nicht gebe. Er würde es eher als „Gefährdung durch diejenigen, die den Islam missbrauchen, bezeichnen“. Diese Gefährdung sei, so Funke weiter, „selbstverständlich in Syrien“ eine ungeheure Gefahr“. Aber es sei „abzuschichten“, zu differenzieren und nicht von „Islam als Islam zu reden“. Das sei auch mit Blick auf den rechtspopulistischen Diskurs wichtig. Und alle demokratischen Parteien, außer den rechtspopulistischen, sähen das auch so, dass man hier eine Differenzierung stützen müsse. Und zwar „angesichts dessen, was sonst an Gefahr blüht“: „Wenn Sie Eskalation haben wollen, kriegen Sie sie“. Seit PEGIDA hätten sich Straftaten mit rassistischen Motiven verdoppelt. PEGIDA sei daran nicht direkt Schuld, habe dies jedoch befördert.
Karakayali nimmt im Anschluss Bezug auf die von von Grünberg genannten Opferzahlen. Diese seien keine offiziellen, sondern offiziell unbestätigte Zahlen, die von Opferverbänden recherchiert worden seien. Die offizielle Zahl läge, glaube sie, bei 48 seit 1989/90. Es gebe erhebliche Defizite „im Bereich des Rechtes“ und in anderen gesellschaftlichen Bereichen, da entsprechende Gewalttaten nicht als politisch rechts motiviert gewertet würden.
Schäffer hat eine weitere Frage an den Sachverständigen Sturm. In Bezug auf die Neonaziszene möchte Schäffer wissen: „Was ist das eigentlich? Wie funktioniert so eine rechte Szene?“ Wie abgeschlossen oder auch wie durchlässig sei sie, auch in Bezug zu anderen Subkulturen? Hier richte sich ihre Frage insbesondere auf Überschneidungen in den Bereich der „organisierten Kriminalität“, beispielsweise „zum Rockermilieu“.
Sturm meint, dass Schäffer mit den Fragen einen wichtigen Aspekt aufgegriffen habe. Denn nach außen entstünde häufig das Bild, dass Nazigruppierungen abgeschlossene Kadergemeinschaften, „sektenartige Gebilde“, seien. Dies sei für einige klandestine Gruppierungen vielleicht der Fall. Insgesamt sehe es aber anders aus. Vor allem die „Dynamik des Rechtsextremismus“ in den 1990er Jahren habe sich dadurch ausgezeichnet, dass es ein „Mitmachangebot“ gegeben habe. „Vermeintlich lose Kameradschaften“ hätten durch Lifestyle, Musik, Idole etc. eine Aktionskultur und „Erlebniswelt“ geschaffen. „Das gemeinsame Machen“ habe im Vordergrund gestanden, ohne dass es Verbindlichkeiten gegeben habe. Hier sei die Szene in gewisser Weise niederschwellig. In der Bewegungsforschung würde von „konzentrischen Kreisen“ gesprochen. Im ersten Kreis, so Sturm, seien wichtige Personen – wie Kader – im Mittelpunkt. Der zweite Kreis bestehe aus Besucher_innen von Veranstaltungen der Szene. Das seien aber „auch vollkommen ideologisierte Aktivisten“. Darüber hinaus gebe es ein weites Feld von Sympathisant_innen, welche z.B. „rassistische Positionen äußern oder diesen rassistischen Positionen etwas abgewinnen können“, die aber auch „in anderen Szenen unterwegs sind“.
Ende der 1970er bzw. Anfang der 1980er Jahre sei hier z.B. die Hooligan-Szene zu nennen. Hier erwähnt Sturm die Hooligan-Organisationen „Borussenfront“ in Dortmund oder die „Adlerfront“ aus Frankfurt. Überschneidungen seien in den 1980er Jahren auch in den Rockerszenen zu erkennen gewesen. Generell sei nach seiner Einschätzung die „Ausweitung des Repertoires an Ausdrucksformen“ auch dazu angetan, dass die extreme Rechte Möglichkeiten auslote, in jeder Jugend- bzw. in jeder Subkultur „Fuß zu fassen“ und Anhänger_innen zu finden. Ein Beispiel dafür sei das Tragen von Che Guevara-T-Shirts, mit denen Neonazis auf Demonstrationen Che Guevara „zum Helden des nationalen Befreiungskampfes gegen den US-Imperialismus verklärt“ hätten.
Lüders erteilt Birgit Rydlewski das Wort.
Rydlewski möchte von Funke eine Einschätzung „zur Vernetzung der verschiedenen Gruppierungen“. Konkret bezieht sie sich auf B&H, Hammerskins und Combat 18. Hier möchte die Obfrau wissen: „Gibt es da so etwas wie Konkurrenz, Feindschaft, Überschneidungen, Vernetzungen?“
Funke möchte auf Beispiele eingehen: B&H sei „die Auffangstation für die untergetauchte Gruppe und das Umfeld (des NSU, Anm. d. Red.) gewesen“. Laut Funke hätten zu dem Umfeld u.a. Thomas S., Jan W., Andreas G. gehört. Diese hätten „natürlich eine eigene Struktur“ gehabt. Darüber hinaus habe es Marcel D. (Thüringen), Thomas S. (Sachsen) und „Pinocchio“ (Berlin) gegeben (gemeint sind vermutlich u.a. Thomas Starke, Jan Werner, Andreas Graupner, Marcel Degner, ehemaliger V-Mann des LfV Thüringen, Anm. d. Red.). Diese hätten bundesweit agiert. In Dortmund habe es die „Streetfighting Crew“ um Oidoxie gegeben und diese Leuten seien eng miteinander „verwandt und international vernetzt“ gewesen. Diesen Gruppen schreibt Funke eine zentrale Rolle beim „Untertauchprozess“ zu.
Nach Funke sei die Einschätzung, dass die Hammerskins in massiver Konkurrenz zu den anderen Gruppen stünden, nicht richtig. Die in den USA gegründeten Hammerskins seien dort für Bombenattentate verantwortlich und international noch „ein Stück mehr vernetzt“. Zentrale Person in der BRD sei für die Hammerskins Mirko H., der in den entscheidenden Jahren V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen sei. Aufgrund dieser V-Leute-Struktur habe es, da müsse er noch einmal zu diesem Thema zurückkommen, massive Konflikte des BKA und des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben, hier vor allem Ende der 1990er Jahre. Das BKA habe darauf gedrungen, V-Leute nicht an die „Spitze der Gewaltszenen“ zu setzen. Es habe hier vor einem „Brandstiftereffekt“ gewarnt. Das „Ausmaß“ der „Verselbständigung“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz habe aber „in der Tat“ dazu geführt, dass V-Leute „an vielen Stellen, und zwar durchaus auch an der Spitze“ der „Gewaltszenen in Deutschland“ gestanden hätten. Ein Beispiel dafür sei Tino Brandt.
Zurück zur Organisation der Hammerskins bemerkt Funke, dass diese im Dortmunder und im Kölner Raum gut vernetzt gewesen seien. Funke benennt zudem Mirko Sz. in Kassel mit Kontakten nach Schweden. Malte Redeker aus Ludwigshafen sei eine weitere Person. Die Organisationen hätten bundesweit kooperiert. Zu Thomas G. heiße es heute in einer Begleitstudie zum Aktionsplan Altenburger Land, dass er gar „nicht mehr von Bedeutung“ sei. Die Polizei meine, er „sei privat geworden“, obwohl er gerade in der bezeichneten Zeit hoch aktiv gewesen sei. Selbst ein Staatsrechtler, den er privat getroffen habe, habe gemeint, dass jeder starke Staat das „schmutzige Instrument Inlandsgeheimdienst“ brauche. Es bedürfe dann aber um so mehr Kontrolle – erzählt Funke von seinem Gespräch mit dem „Staatsrechtler“, der sich zudem auf Carl Schmitt bezogen habe.
Doch Funke kehrt zum Thema zurück. Zum Ku-Klux-Klan führt Funke aus, dass viele der „aktivsten Kader“ der extremen Rechten sich auf den KKK bezögen. Dies sei besonders für Baden-Württemberg zu beobachten, weshalb er sich hier in NRW nicht weiter dazu auslassen wolle.
Lüders bittet keine Nachfragen „zu diesem Themenkomplexes“ zu stellen, da es dazu „ein gesondertes Hearing“ geben werde, „um in diesen Bereich einzusteigen“.
Ibrahim Yetim (SPD) stellt zwei Fragen bzgl. des „gesellschaftlichen Status der Rechtsextremen“: Man sage ja: ‚Je ärmer, desto anfälliger‘. Ferner interessiert sich Yetim für die Rolle der Medien. Yetim möchte die Fragen vor dem Hintergrund beantwortet wissen, dass es derzeit wieder Debatten um „Armutszuwanderung“ und „Flüchtlingsströme“ gebe. Und die Sachverständige Karakayali habe hier erläutert, welche Bedeutung die politischen Debatten auf „die Entwicklung der Rechtsextremisten haben“. Ob man schon einen „Trend“ absehen könne, welchen Einfluss diese nun aktuellen Debatten auf die Rechtsextremen jetzt hätten?
Sturm beginnt mit der Beantwortung der ersten Frage und warnt davor zu sagen, dass Rechtsextremismus ein „Phänomen der sozialen Unterschichten“ sei. Es habe natürlich viel mit Unsicherheit und einer Verunsicherung zu tun. Diese habe jedoch nicht ausschließlich ökonomische Ursachen, wie auch Funke am Beispiel der Nach-Wendezeit verdeutlicht habe. Sturm verweist hier wiederum auf die Heitmeyer-Studie zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie weitere Einstellungsuntersuchungen und plädiert dafür, sich deren Ergebnisse anzuschauen. Eine Studie zur Offenheit für rechtsextreme Einstellungen im Bereich der Gewerkschaften (Richard Stöss: Gewerkschaften und Rechtsextremismus in der Region Berlin/Brandenburg, 2000, Anm. d. Red.) zeige hier Interessantes: Insbesondere Facharbeiter, „die tatsächlich noch in Lohn und Brot stehen und gut qualifiziert sind“, würden entsprechende Einstellungen vertreten. „Angst vor Abstieg“ und „sozialer Marginalisierung“ seien hier also als relevant anzunehmen. Als weiteres Beispiel führt Sturm das Verbot der „Skinheads Sächsische Schweiz“ an. 2001 sei die „100, 120 Aktivisten“ starke Gruppierung vom sächsischen Innenministerium verboten worden. Hausdurchsuchungen hätten gezeigt, „dass die führenden Kader“ aus einer Schicht oder einem Milieu gekommen seien, das ein hohes Ansehen genossen habe. Darüber hinaus verweist Sturm auf die Wahlergebnisse von „rechtsextremen Parteien“ in Bayern und Baden-Württemberg, welches vergleichsweise reiche Bundesländer seien.
Karakayali greift die Frage zu den Medien auf und verweist abermals auf die PEGIDA-Demonstrationen. Unter den vielen Menschen, die dort auf die Straße gingen, seien auch Rechtsextreme und Neonazis. Man müsse sich auch fragen, warum in bestimmten Städten mehr Bürger zu den Demos kommen als in anderen. Hier sei es wichtig zu sehen, ob und wie gut hier oder dort die extreme Rechte aufgestellt sei. Andererseits: Wenn Horst Seehofer das Schlagwort vom „Weltsozialamt“ benutze, werde er schon wissen, was er „da tut“. Das mache er doch „nicht zufällig“. Vielmehr gehe es darum, „genau diese Menschen, die zum Beispiel in Dresden auf die Straße gehen“, als potentielle Wähler_innen „mit solchen Sprüchen zu vertreten.“
Darüber hinaus gebe es ein Problem, „weil Nationalstaaten darauf ausgerichtet sind, dass sie definieren müssen, wer dazugehört und wer nicht. Das tut die extreme Rechte ebenfalls“. Karakayali sieht den Versuch, die extreme Rechte in eine „Art tödliche Umarmung zu zwingen“ kritisch. Wenn man Parolen ausgebe, dass es z.B. rechts von der CDU/CSU „nichts geben darf“, führe dies auch dazu, dass „Positionen nach rechts schwenken.“ So sei es eine entscheidende Aufgabe der Politik, sich darüber Gedanken zu machen, wo und wie hier Grenzen zu ziehen seien – und über die Frage, wie sich die parlamentarische Politik zur extremen Rechten verhalte.
Da die Ausschussvorsitzende nicht im Raum ist, moderiert Biesenbach als stellvertretender Vorsitzender an ihrer statt weiter und erteilt Verena Schäffer das Wort.
Schäffer (GRÜNE) möchte auf den Begriff des „politischen Soldaten“ zurück kommen. Sie fragt: „Welches Selbstverständnis haben diejenigen, die aktiv sind und auch gewaltbereit sind? Als was verstehen sie sich selbst?“ Was seien hier Eigenmotivation und Legitimation?
Sturm geht auf Schäffers Frage ein. Der Begriff des politischen Soldaten stamme aus der Weimarer Republik, hier vor allem aus dem Zusammenhang der SA, aber auch der extrem rechten Freikorps der frühen 1920er Jahre. Die Bezugnahme auf dieses Konzept sei ganz bewusst. So etwa habe Michael Kühnen ausdrücklich an die Traditionen der historischen SA angeknüpft. Er habe sich dadurch von der „damals behäbigen“ NPD abgrenzen wollen. Im Prinzip gehe es in erster Linie natürlich um eine Selbstinszenierung, beides, Stil und Selbstsinszenierung seien dabei aber schon fast mit politischem Inhalt gleichzusetzen: Man sehe sich sozusagen als Gruppe, die geschlossen aufmarschiert, die auf der Straße Stärke repräsentiere und sage: Der Nationalsozialismus werde nicht im Parlament erstritten, sondern auf der Straße erkämpft. Beispiele seien Aufmärsche oder Erinnerungsveranstaltungen, die der Identitätsbildung der Gruppe dienten (z.B. Schlageter-Gedenken). Es sei „eine Haltung, die man sich „auch relativ billig aneignen“ könne, so Sturm.
Funke ergänzt wieder: Der Film „Der Triumph des Willens“ gehöre auch zu einer Inszenierung. Damals, 1934, als der Film gedreht worden sei, habe er die „totale Macht“ gehabt. Man habe eine „zweite Realität neben die normale geschoben“, wenn man die „paranoide, verrückte, irrsinnige Idee“ gehabt habe, dass man, „wenn man die Juden loswerde, frei sei“. Funke bezeichnet dies als eine „Form“ des „exzessiven Rassismus“. Und so etwas hätten wir bei der NPD heute auch. Kollege Sturm habe gesagt, dass „das, was die NPD mit dem Rückführungsprogramm will, radikaler ist, als das, was die NSDAP damals in ihrem Gründungsparteiprogramm 1920 wollte“. Das sei die „historische Herausforderung“, von der man immer noch lernen könne: den „Anfängen zu wehren“. Funke zitiert in der Folge schließend Michael Kühnen zum Begriff des politischen Soldaten.
Stamp (FDP) fragt, mit Hinweis darauf, dass er vielleicht Gefahr laufe, sich nach der nun schon langen Sitzung unbeliebt zu machen, danach, welche Rolle „in dem gesamten Konglomerat“ die sogenannte „Neue Rechte“ spiele, die aus Frankreich „herübergeschwappt“ sei. Stamp nennt hier Alain de Benoist, die „Junge Freiheit“. Dies sei, so Stamp, der Versuch einer Intellektualisierung des Rechtsextremismus gewesen. Wie vertrage sich dieser Impuls damit, dass es „auf der anderen Seite diese Speerspitze gegeben hat, die, wie Herr Prof. Funke vorhin gesagt hat, radikaler als Hitler ist?“ Wie sei der Zusammenhang hier zu sehen?
Funke: Alain de Benoist sei dafür bekannt, dass er „Mein Kampf“ verlegt habe. Benoist sei Vertreter der Auffassung, dass „ethnische Differenzen anzuerkennen seien“. Auch wenn das erstmal gut klinge, sei „die Übersetzung […]: ‚Deutschland den Deutschen, die Türkei den Türken‘. Spaltung“. Bei Benoist habe es dann aber einen differenzierten Dreh gegeben. Er habe gesagt, dass man alle achten müsse, aber in ihrem Heimatland. Die „Junge Freiheit“ sei da anders, da gebe es „richtige Debatten“, da gebe es auch „Spaltungen“. Die „Junge Freiheit“ bediene auch „Rechtskonservative oder Nationalistisch-Konservative“. Zugleich habe sich die „Junge Freiheit“ eher auch darum bemüht, „rechtspopulistisch zu agieren“. Genau darum habe es auch Abspaltungen von Leuten gegeben, die radikaler sein wollten. Dies treffe etwa auf Götz Kubitschek zu. Es ginge um Werteveränderung.
Sturm ergänzt eine Anmerkung zum „gesamtgesellschaftlichen Einfluss der Neuen Rechten“. In der Bilanz seien sie mit ihren Zielen „erst einmal als relativ gescheitert“ zu betrachten. Auch wenn das Ende der 1960er, also zu dem Zeitpunkt, „zu dem auch die militante Neonaziszene entstanden ist“, anders gewesen sei. Zäsur sei hier das „Scheitern der NPD bei der Bundestagswahl 1969“ gewesen. Darüber hinaus gebe es immer wieder thematische Überschneidungen zwischen militanten Neonazis und der Neuen Rechten. „Es gibt hier […] tatsächlich wieder einen gemeinsamen ideologischen Kern“. Ideen der neuen Rechten seien z.B. auch in programmatischen Texten der NPD aufgetaucht. Es sei jedoch als Versuch zu werten, der eigenen Haltung zu einer „neuen ‚Modernisierung‘ – in Anführungszeichen“ zu verhelfen, wenn auf Oswald Spengler, Moeller van den Bruck oder Ernst Jünger Bezug genommen würde. Hier gehe es nicht um Auseinandersetzung, sondern vielmehr um „Stil“ bzw. Selbstinszenierung.
Lüders schaut „mal in die Runde“ und erkundigt sich, ob es „noch Nachfragen“ gebe. „Das ist nicht der Fall“. So bemerkt die Vorsitzende, dass sie die Ausführungen „sehr, sehr interessant, aber an manchen Stellen auch erschlagend“ gefunden habe. An die Obleute gerichtet gibt sie zu bedenken, ob es möglicherweise noch einen zweiten Termin geben könne, denn „an vielen Stellen hätte man auch noch gut in die Tiefe gehen können“. Aber irgendwann, so Lüders, sei „der Speicher da oben auch voll. Zumindest geht mir das so.“ Lüders bedankt sich bei den Sachverständigen. Nach fünf-minütiger Pause werde die Ausschuss-Sitzung mit dem nicht-öffentlichen Sitzungsteil fortgesetzt. Der öffentliche Teil ist um 16:25 Uhr beendet.